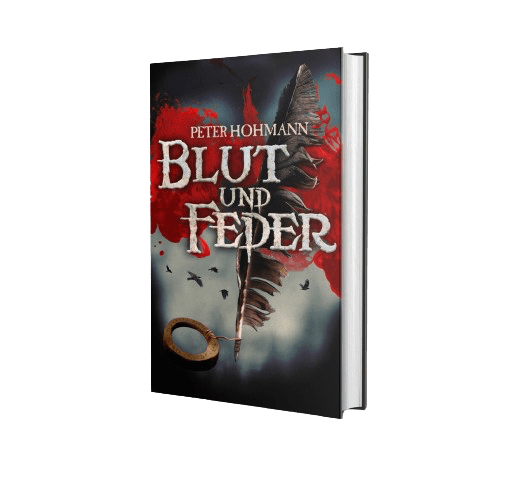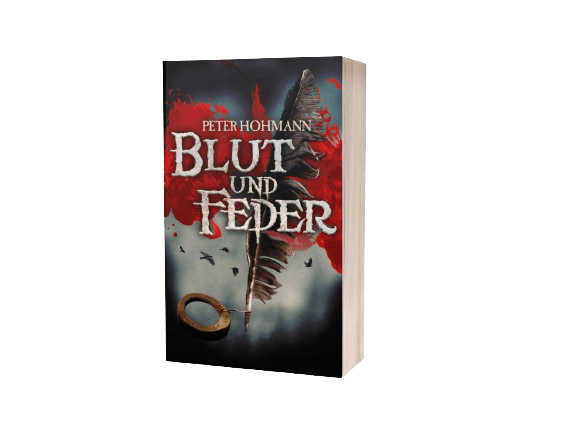Blut und Feder
Germanische Mythologie, verwoben mit dem phantastischen Zauber einer düsteren Erzählung über Hass, Rache, Liebe und einem Geheimnis, in dessen Tiefen ein namenloser Schrecken lauert

Alles hat seinen Preis – Glück, Liebe, Hoffnung. Eines Tages muss diese Schuld beglichen werden – und manchmal muss man viel mehr geben, als man einst bekam …
Ein düster angehauchter Fantasy-Roman im historischen Kontext Germaniens, einer Epoche voller Mythen, Legenden und gefährlicher Magie. Das Christentum breitet sich aus, doch die alten Götter wie Odin und Thor sind weiterhin stark. Dämonische Kräfte sind am Werk – auch wenn die schlimmsten Dämonen jene in Menschengestalt sind.
Hoimar ist ein Ausgestoßener, ein Verfluchter, der angeblich Unheil bringt und deswegen sterben soll. Eine geheimnisvolle Frau aber bewahrt ihn vor dem sicheren Tod. Fortan glaubt er, sein Leben würde sich zum Guten wenden, denn er ist in Sicherheit – und verliebt in seine Retterin.
Doch diese Annahme ist ein Trugschluss: Er verfängt sich im Netz dunkler Begierde, unheilvoller Magie und eines sich ausbreitenden Konflikts, der nicht nur ihn vernichten könnte, sondern alles, an was er glaubt und was er liebt.
In den finsteren Wäldern Germaniens lauert der Tod ...
Das Jahr 741 n. Chr.
Die Katholische Kirche entsendet Mönche, um die germanischen Stämme zu missionieren. Nicht nur viele Häuptlinge wehren sich dagegen, ihren Glauben an Odin und die anderen Götter abzustreifen. Auch eine mysteriöse Frau kämpft dagegen an, und zwar mit Mächten, die den dunkelsten Niederungen der germanischen Folklore entstammen.
In diesen Konflikt gerät auch Hoimar, ein junger Mann, den sein eigener Stamm meidet und sogar foltert. Der Grund: Seine Haut strahlt alabasterweiß und seine Augen leuchten in unheilvollem Rot. Als man ihn töten will, erscheint die mysteriöse Frau und rettet ihn.
Aus Dankbarkeit wird er ihr Schützling, und sie lehrt ihn Dinge, die man mit Aberglaube nicht mehr erklären kann. Der Preis für dieses Wissen ist jedoch viel höher, als er ahnt. Denn auch seine Mission wird es sein, den Tod zu bringen …
Ein düsterer und schonungsloser Roman, in dem sich geschichtliche Fakten mit den finsteren Riten der nordischen Mythologie mischen.
LESEPROBE
Jetzt auf Kapitel 1 klicken.
PROLOG
Das Jahr 741 n. Chr.
Die Schwingen ausgebreitet, glitt Flüsterwind durch die Winternacht. Aus gelben Augen beobachtete der Bartkauz das unter ihm dahinziehende Waldland, spähte nach huschenden Bewegungen am schneebedeckten Boden, hoffte auf Eichhörnchen oder Mäuse, die zwischen Erdkuhlen und den Stämmen der dicht stehenden Tannen, Kiefern und Fichten umherflitzten. Hier jedoch rührte sich nichts, außer den Nebelstreifen, die von der sanften Brise in immer neue Muster gepustet wurden. Leise glitt Flüsterwind hinab zu den Bäumen, auf deren Zweigspitzen sich zollhohe Schneehäubchen türmten, ließ sich auf einem Ast nieder, dass glitzernde Kristalle hinabrieselten, und faltete die Fittiche an den Körper.
Abermals dachte er an Nahrung.
Nein, die Suche, sie war wichtiger. Seinen Hunger stillen würde er erst, wenn es nicht anders ginge. Nur diese kurze Rast, dann würde er weiterfliegen. So hockte er in dem Baum, ein Schatten unter vielen, und rupfte sich mit dem Schnabel ein paar krumme Federn aus dem dichten Kleid.
Geräusche.
Das Brechen der harschigen Schneedecke, das Knacken kleiner Wechten, die unter Druck nachgaben. Atemzüge. Kurze Zeit später sah Flüsterwind einen Lichtpunkt, der sich zwischen den Stämmen bewegte, dabei leicht auf- und abwippte. Die Flamme warf flackernde Schatten durch den Wald. Es waren vier Gestalten, die sich durch den tiefen Schnee mühten. Sie schnauften und keuchten, ihre Schritte so laut, dass man sie weithin hörte: Flügellose. Wie alle ihrer Art bewegten sie sich plump und ungelenk, und da sie keine Federn besaßen, waren sie – wie alle ihrer Art – in irgendwelche Fetzen gehüllt, die sie anderen Tieren gestohlen hatten.
Was hatte sich die Natur nur bei ihrer Erschaffung gedacht? Der mit dem Feuer, das an einem langen Stock brannte, hielt inne, und seine Schultern sackten nach unten. Er stieß diese sonderbaren Laute aus, derer sich die Flügellosen bedienten; manche brummten wie Bären, andere krächzten wie Krähen, und manche fiepten wie die Erdmäuse, wenn Flüsterwind seine Krallen in sie schlug.
Lediglich eine Flügellose verstand der Bartkauz.
Und lediglich einer Flügellosen fühlte er sich verbunden.
Aber die war nicht hier, sondern weit weg.
Während Flüsterwind sich über die Flügellosen wunderte, blieben die anderen drei hinter dem Fackelträger stehen.
„Was hältst du an, Otker?“, murrte der hinterste, ein stämmiger Bursche, unter dessen zotteligem Umhang die Ringe eines Kettenhemdes glommen. Mit der rechten Hand, die in einem Fäustling steckte, hielt er die Leine eines Packesels, der mit der Schnauze im Schnee herumwühlte und einen Büschel Altfarn herausriss.
Der Angesprochene machte eine unwirsche Geste mit dem Fackelstiel, dass die Flammen zornig fauchten. „Ich habe doch gesagt, dass ich keinen Schritt mehr gehe. Keinen einzigen!“
Der mit dem Kettenhemd, Bertulf mit Namen, verschränkte die Arme vor der Brust. „Erst damit prahlen, dass du den Weg auch mit verbundenen Augen findest, und dann plötzlich rumjammern – das habe ich gern!“
„Mäßigt euch“, sagte da der hagerste von ihnen, der eine braune Kutte trug, genau wie sein Begleiter, unter dessen Robe sich allerdings ein stattlicher Spitzbauch wölbte. „Streit bringt uns nicht weiter.“
„Weise Worte, Bruder Emmeran“, schnaufte der Dicke und drückte ächzend das Kreuz durch. „Lasst uns hier rasten. Der neue Tag wird uns den Weg weisen, so der Herr dies möchte.“
„Das denke ich auch, Bruder Folmar“, sagte Emmeran.
Bertulf stampfte mit dem Fuß in den Schnee. „Morgen gehe ich vor, Otker! Sonst führst du uns noch in ein Sumpfloch oder über einen vereisten See, so dass wir einbrechen und elendiglich ersaufen!“
Otker steckte die Fackel Stiel voran in eine Schneewehe, entledigte sich mit erzürnten Rüttelbewegungen seines Fellranzens und warf ihn in die weiße, unberührte Puderschicht, dass es nur so stäubte. Dann stapfte er zum Packesel, der ihn mit mahlenden Kiefern anblickte, und zerrte eine Decke aus der Satteltasche. Beim Zurückgehen warf er Bertulf einen finsteren Blick zu.
Bertulf zog Rotz hoch und sandte einen Schleimpfriem auf die Reise, der gegen einen der Stämme klatschte.
„Denkt daran“, sagte Emmeran mit seiner knarrenden Stimme, die klang wie eine rostige Türangel, „was Jesus Christus erleiden musste, was er für uns alle auf sich nahm. Da ist eine Nacht im Freien nicht weiter schlimm.“
Bruder Folmar nickte pflichtschuldig, auch wenn sein rundliches Gesicht mit den vor Kälte geröteten Pausbacken verriet, dass ihm sein eigener Vorschlag mit jedem Atemzug weniger behagte.
Schweigsam bereitete die kleine Gruppe ein Lager in der kälteklirrenden Nacht vor, zwei wackelige Leinenzelte, Decken und Essgeschirr. Bertulf brachte mithilfe der Fackel rasch ein kleines Feuer zugange, und wenig später schlürften sie eine dünne, aber immerhin wärmende Brühe in ihre kalten, vor Hunger grimmenden Mägen. Nachdem sie die letzten Reste aus ihren hölzernen Schüsseln gekratzt hatten, saßen sie vor dem Feuer, streckten die Hände nach den Flammen aus.
„Nun wollen wir beten“, sagte Emmeran, faltete die Hände und neigte den Kopf. Folmar tat es ihm gleich, und auch die beiden Söldner senkten ihre Häupter.
„Gedankt sei dem Herrn“, brummelte Emmeran, „für dieses Mahl, das, obwohl karg, doch unsere Bäuche wärmte. Danken wir Kaiser Konstantin, der einst das leuchtende Zeichen des Herrn am Himmel erblickte und Seine Stimme vernahm. Danken wir unserem Bruder Bonifatius für seinen Mut und seine Glaubensstärke, und natürlich dafür, dass er uns das Vertrauen zumisst, diese heilige Mission in seinem Sinne zu erfüllen. Amen.“
„Amen“, kam es leicht versetzt von den anderen, sodass es wie das Echo eines Echos klang. Danach herrschte Schweigen. Jeder konzentrierte sich darauf, wie die Wärme von den Fingerkuppen aus den gesamten Körper durchströmte.
„Ich möchte Euch nicht vor den Kopf stoßen, Bruder Emmeran“, brummte Bertulf nach einiger Zeit, nahm die Hände zurück und steckte sie unter seinen Bärenfellumhang, „aber weshalb zieht Ihr diese Lausekälte den wärmenden Mauern der Mönchskloster vor?“
„Gottes Wort in die Welt zu tragen ist mein Auftrag, und keine Unbill wird mich davon abhalten.“
„Wieso überlasst Ihr das nicht den Jüngeren Eurer Gemeinschaft – wie Bruder Folmar zum Beispiel?“
„Die Jüngeren“, antwortete Emmeran, wobei er das Wort Jüngeren so aussprach, als hätte er es vorhin mit aus der Schüssel geschlabbert, „mögen kräftige Körper haben, doch mangelt es ihnen oft von Geistes wegen.“
Otker kicherte leise, blickte jedoch rasch zur Seite, als ihn Emmerans strafender Blick aus von Falten umkränzten Augen traf, und begann, mittels eines abgefallenen Asts Zeichen in den Schnee zu ziehen.
„Seht Ihr das genauso, Bruder Folmar?“, erkundigte sich Bertulf, seine Stimme arglos, obwohl es ihm eine diebische Freude bereitete, den Gottes-Gesellen ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Würde Bonifatius nicht ein erkleckliches Sümmchen römischer Münzen dafür kredenzen, dass er die Brüder beschützte, würde ihm bestimmt etwas Besseres einfallen, als sich in diesem vermaledeiten Wald den Arsch abzufrieren.
Der Prediger rutschte auf seinem dicken Hintern herum, als säße er nicht auf einer Decke, sondern urplötzlich auf einem harten Baumstubben, und leckte sich über die Lippen. „In der Tat ist es mit einem Mönch wie mit … mit … gutem Wein. Je länger er lagert, also je länger er halt nicht sofort getrunken wird, desto besser …“
„ … schmeckt er?“, grinste Bertulf.
Folmers Röte der Kälte auf seinen Backen bekam Gesellschaft von der Röte der Scham. „Nein, also, eigentlich ja. Was ich meine, ist, dass je länger er lagert, desto …“
Emmerans Gesicht knautschte sich zusammen wie zu weiches Stiefelleder. „Redet nicht so einen Unsinn“, kanzelte er Folmar ab. „Es verhält sich nun einmal so, dass der Geist reifen muss.“
Bertulf grinste noch breiter. „Wie Wein eben.“
Ohne darauf einzugehen fuhrt Emmeran fort: „Er reift durch Einkehr und Gebet, und er wächst am Vorbild der Taten weiser Mitbrüder. Prior Bonifatius ist ein solch erleuchteter Bruder. Früh erkannte er, wie wichtig es ist, den Heiden des Nordes die Augen für die Pracht des Herrn zu öffnen, damit sie ihren niederen Götzen entsagen. Dergestalt werden sie ihr Seelenheil sichern.“
Otker schleuderte den Ast in die Finsternis der Bäume, reckte die Hände gegen das Feuer und sah Emmeran von der Seite an. „Bislang waren die Barbaren eher zurückhaltend, würde ich sagen …“
Emmeran bedachte ihn mit einem finsteren Blick, und Otker zuckte unmerklich zusammen und schien sich plötzlich ganz fest darauf zu konzentrieren, den perfekten Abstand der Handflächen zu den Flammen zu finden.
Bertulf verzog das Gesicht. Ein Blick des hakennäsigen Priesters, und dem Kerl rutscht das Herz bis runter zum Arschloch. Will nicht wissen, wie der reagiert, sollten wir mal überfallen werden oder die Wilden sich mit etwas anderem als Worten gegen Emmerans Bekehrungsversuche wehren …
Der ältliche Priester atmete tief durch. „Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Aber es ist unsere Aufgabe und damit unsere göttliche Pflicht. Punktum.“ Dann bannte er Bertulf mit dem Blick seiner wässrig-grauen Augen, und Bertulf merkte, wie auch er zu schrumpfen schien. Verdammt noch eins, diese Priester waren aber auch ein unheimliches Volk!
„Ihr glaubt doch an Gott?“ Das Wässrige in Emmerans Augen gefror. „Oder etwa nicht, Bertulf?“
„Natürlich, natürlich. Da gibt´s keinen Zweifel.“
Am meisten glaubte er an ordentliche Bezahlung. Das jedoch würde er Emmeran bestimmt nicht auf die Nase binden.
„Dann ist es ja gut“, erwiderte Emmeran und erhob sich ächzend. „So habt Ihr bestimmt nichts dagegen, wenn Ihr das nächste Mal, wenn wir ein Dorf erreichen, den Wilden die Vorzüge des christlichen Glaubens anpreist, anstatt gelangweilt in der Gegend herumzustehen.“
„Eine gute Idee, Bruder Emmeran. Ich werde es mir merken.“
Der Mönch nickte knapp, dann ging er zu einem der Zelte. Die Plane in der Hand, drehte er sich herum. „Bruder Folmar. Da die Jüngeren ja – wie bereits erwähnt – vor lauter Jugend kaum wissen, wohin mit ihren Bärenkräften, habt Ihr sicher nichts dagegen, die heutige Nachtwache zu übernehmen?“
Folmar schluckte. „Die ganze?“
Ohne zu antworten bückte sich Emmeran in das Zelt und verschnürte die Plane von innen.
Bertulf und Otker, obwohl selten einer Meinung, grinsten sich über beide Ohren an und erhoben sich unisono.
„Nun denn, Bruder Folmar“, sagte Bertulf, sich Schnee vom Umhang klopfend, „eine ereignislose Nacht wünsche ich.“
„Danke …“, brummelte Folmar und guckte betröpfelt auf seine Stiefelspitzen.
Otker tippte sich mit dem Zeigefinger in überschwänglichem Gruß gegen die Stirnwulst seiner Fellmütze, sagte „Dem kann ich mich nur anschließen“ und folgte Bertulf ins Zelt.
Hoffentlich drehen sich die beiden Mietschwerter gegenseitig die Gurgeln um heute Nacht, hämmerten Folmars Gedanken kalt, und Emmeran soll an seiner eigenen Galle ersticken!
Er hockte sich auf die Decke, blickte in die Flammen und wünschte sich an einen anderen Ort. Jedoch, nicht einmal die Vorstellung von Sonne, von Blumen und im Wind treibenden Blüten auf einer herrlichen Waldlichtung vermochte die Kälte auf Abstand zu halten. Verdammter Norden! Verdammte Wälder! Verdammte Barbaren! Ein leidlich einträglicher Posten als Schreiber in einem Mönchsstift hätte ihm mehr als gereicht. Aber nein, da wählte Emmeran ausgerechnet ihn, Folmar, aus, um ihn auf dieser Bekehrungs-Irrfahrt zu begleiten. Gottes Wille hin oder her – es gab dutzende andere Priester, die sich die Finger danach abgeschleckt hätten, durch diese ach so heilige Mission in der Gunst Bonifatius´ zu steigen – und somit in der klösterlichen Hierarchie.
Da konnte man tausendmal runterbeten, wie sehr Christus am Kreuz gelitten hatte. Bruder Folmar konnte Leid nichts abgewinnen! Und ja, er litt: unter Kälte, unter Hunger, unter Emmeran und diesen beiden ungeschlachten Haudraufs, die hinter seinem Rücken Witze über ihn rissen. Mit einem Seufzen wuchtete er seinen Leib in die Höhe und ging zum Packesel, der ihn blöde anguckte. Ein Blick über die Schulter – alles ruhig, bis auf Bertulfs Geschnarche, das mühelos durch die Stoffbahn des Zeltes in die Nacht drang – öffnete er den Deckel des kleinen Fasses, das in einem Futteral am Tragegeschirr des Esels hing. Das Bier war eigentlich für den Rachen eines dieser verlausten Häuptlinge gedacht, auf dass das Wort Christi gut geschmiert in sein Innerstes rutsche und ihn dazu bewege, seine Gefolgsleute auf das Christentum einzustimmen.
Das Fehlen eines kleinen Schlucks würde niemand bemerken.
Folmar tauchte den Becher ins Fass.
Klack.
Verwundert stippte er den Finger hinein.
Eis.
Ein Seufzer aus tiefstem Herzensgrund. Stellst Du uns nicht schon genug auf die Probe, Herr? Reicht es denn nicht, dass wir Dein Wort in die letzten Winkel dieses Niemandslandes tragen? Musst Du da auch noch das Bier zu Eis verwandeln?
Dann wich der enttäuschte Ausdruck aus Folmars Gesicht, und ein breites Lächeln hob seine Bäckchen zu zwei feisten Knubbeln. Er ging auf die andere Seite und öffnete eine der Taschen, griff hinein und erfühlte das Bündel. Schnell hatte er es entschnürt. Mit spitzen Fingern nahm er einen Speckstreifen zwischen die Zähne, rollte das Päckchen wieder zusammen und verstaute es.
Sein Magen gluckerte vor Freude, während er eine Pfanne holte und den Speckstreifen hineinlegte. Die Pfanne in der rechten Hand, sodass er sich beim Hinsetzen nur mit der linken abstützen konnte, ließ er sich unbeholfen auf den Hintern plumpsen. Dabei geriet er ins Ungleichgewicht und rollte auf den Rücken, sodass er für einen Moment wie ein Käfer mit den Beinen ruderte. Unter viel Mühe gelang es ihm, sich aufzurichten.
„Nein!“, stieß er dann hervor: Der Speck lag im Schnee. Er klopfte und pustete den Streifen ab und platzierte ihn wieder in der Pfanne. Gerade wollte er sie über die Flammen halten, da schnitt ein lautes Heulen durch den Wald, schauerlich, unheimlich. Flugs legte er die Pfanne zur Seite und stand auf. Sein Herz pochte hart wider den Brustkorb.
Wölfe.
Erneut wand sich das Jaulen wie eine Anrufung des Mondes in den eisigen Himmel.
Die greifen keine Menschen an. Schon gar nicht eine ganze Gruppe. Nein, bestimmt nicht …
Trotzdem stierte er zwischen die Stämme jenseits des flackernden Lichtscheins des Lagerfeuers, suchte nach gelben Augenpaaren, die unverwandt zurückstarrten. Lauschte nach dem Tapsen von Pfoten im Schnee, meinte schon, das heisere, gierige Atmen der Wölfe zu hören, die sich bereit machten, den dicken Priester zu Boden zu werfen und ihm die Kehle rauszureißen. Stocksteif stand er da, sein eigener Atem so laut wie das Pfeifen eines Blasebalgs.
Nichts.
Kein weiterer Wolfsruf. Wahrscheinlich waren die Biester weit, weit weg. Der Wald und die Kälte narrten die Sinne, gaukelten vor, Entferntes wäre ganz nah.
Erleichtert ausatmend drehte er sich schließlich herum – und gewahrte einen schwarzen, monströsen Schatten, der lautlos heranschoss!
Mit einem Aufschrei taumelte er rückwärts, trat ins Feuer, dass die Funken stoben und eine wabernde Lohe nach oben stieg wie ein Feuerdämon. Unsanft landete er auf dem Rücken, sein Atem rauschte ihm aus den Lungen. In Todesangst glotzte er den Angreifer an.
Blinzelte.
Es war ein Kauz.
Der Vogel bedachte ihn mit einem abschätzigen Blick – und schnappte sich den Speckstreifen aus der Pfanne!
„Du Ausgeburt!“, knurrte Folmar und raffte sich auf.
Zu spät. Ein paar grazile Flügelschläge, und der Kauz glitt über den Wipfeln davon.
In diesem Moment hörte er ein Brummen. Eine Plane wurde zurückgeschlagen, und Bertulf schaute heraus, ein Schwert in der Hand. „Was brüllst du denn rum, zum Teufel?“
„Äh“, machte Folmar und riss den Blick von der Stelle los, wo der Kauz mit der Nacht verschmolzen war. „Wölfe …“ Er schluckte und seufzte. „Habe gedacht, Wölfe schleichen ums Lager.“
Bertulf schüttelte den Kopf. „Blödsinn. Die haben Angst vor Feuer.“ Er ließ die Klinge sinken und schob sich rückwärts ins Zelt. Die Plane fiel zurück vor den Eingang. Bertulf sagte noch etwas, doch es war zu leise und gedämpft.
„Was hast du gesagt?“
„Ich habe gesagt, du brennst!“
Folmar erschrak und sah an sich herab. Kleine Flammen fraßen sich in den Saum seiner Kutte! Panisch klopfte er daran herum, verbrannte sich die Finger. „Verdammt!“ In Ermangelung einer anderen Möglichkeit warf er sich in den Schnee. Es zischte, und Rauch stieg auf.
Verzweifelt schloss er die Augen und blieb liegen; kein Bier; von einem Kauz beklaut; angesengte Robe; sich nun endgültig zum Trottel gemacht.
„Ich habe verstanden, Herr …“
*
Flüsterwind schwebte durch die Lüfte, hoch über den Wipfeln, und der Mond, weiß und rund, glühte wie junges Feuer. Der Bartkauz war zufrieden, das Fleisch des Flügellosen hatte den ärgsten Hunger gestillt, auch wenn es sonderbar geschmeckt hatte, als wäre das Tier längst tot gewesen. Seltsam, was die so alles fraßen. Wie konnte man altes Fleisch dem saftigen, bluttriefenden Schenkel einer Erdmaus vorziehen? Der Wind trieb ihn voran, er ritt auf seinen sanften, säuselnden Wellen über das Land, bis er auf einen großen Nesthaufen der Flügellosen stieß. Viele der länglichen Nester befanden sich innerhalb des Rings angespitzter Bäume, mit welchen die Flügellosen sie umkränzten. Die Luft über dem Nistplatz stank, und alles in Flüsterwind empörte dagegen auf, hier länger zu bleiben. Feuer bedeutete Gefahr. Aber er hatte gelernt, diese Angst zu überwinden. Aus zahlreichen viereckigen Öffnungen über den Dächern stieg Rauch auf.
Wachsam glitt er nach unten, drehte ein paar Kreise, um sicherzustellen, dass kein Räuber ihm auflauerte, und ließ sich auf dem schneebedeckten Giebel eines Daches nieder. Die Flügellosen mieden die Nacht, warum auch immer. Nur selten zeigten sich welche. Ihm blühte wohl – wieder einmal – eine Nacht des Wartens, bis der Morgen anbrach und die Flügellosen aus ihren Nestern krochen. Plötzlich jedoch vernahm er Geräusche. Es war das raue Krächzen ihrer merkwürdigen Sprache, das Flüsterwinds Ohren marterte wie der Rauch seine Nase. Trotzdem blieb er sitzen und spähte in die Richtung der Laute. Vier Flügellose kamen langsam näher. Sie gaben sich nicht einmal Mühe, leise zu sein, sondern krakeelten herum. Wie die so jemals Beute fingen, war Flüsterwind ein Rätsel. Eigentlich müssten sie verhungern. Diese Gruppe war noch unbeholfener als ihre Artgenossen. Ihr Nachteil, keine Flügel zu besitzen, verstärkte sich durch ihren komischen Gang. Bisweilen hielten sie sich sogar aneinander fest, um nicht in den Schnee zu fallen, torkelten und taumelten. Vielleicht waren es junge Schlüpflinge, die noch lernen mussten?
Plötzlich blieb einer stehen, reckte irgendetwas in die Höhe, ähnlich Flüsterwinds Trinkgefäß, das er benutzte, wenn er daheim war. Dann riss er den Mund auf, kippte die Hand. Wasser ergoss sich daraus. Vieles davon verfehlte seinen Rachen und lief über sein gestohlenes Fell. Ungeschickt, wirklich, sehr ungeschickt. War es überhaupt Wasser? Nein, es war dunkler, und der Wind trieb eine herbe Note an Flüsterwinds Nase.
Die anderen Schlüpflinge warfen nun auch die Köpfe in den Nacken, johlten furchtbar laut. Der Besudelte schleuderte das Gefäß fort. Einer fiel gar auf den Boden und rollte herum, was den anderen neuerliches Gekreische entlockte; der nächste sank vornüber, stützte sich auf die dicken Beine, als liefe auch er Gefahr, in Bälde am Boden herumzukollern.
Flüsterwind plusterte sich auf, trat von einem Bein auf das andere und rupfte eine Feder aus. Am liebsten wäre er weitergeflogen. Aber seine Aufgabe, die war wichtig. Und deshalb musste er ausharren. Zur Beruhigung neigte er den Kopf, öffnete den Schnabel und biss zaghaft in das Band aus dreifach gedrilltem Wurzelfaden, das um sein rechtes Bein verlief, und an dem ein kleiner, metallener Ring befestigt war, in den, hauchfein und kaum zu sehen, Gravuren ziseliert waren. Das Gefühl von Vertrautheit durchströmte Flüsterwind, von Ruhe und Geborgenheit.
Er hob den Kopf.
Die Flügellosen waren nun bei dem Nest angelangt, auf dem er hockte. Aufmerksam blickte er jeden von ihnen in die Augen. Enttäuscht plusterte er sich abermals auf. Ein Rumpeln ertönte unter ihm. Wieder sprachen die Flügellosen. Diesmal klangen sie anders, aggressiver. Jagten sie gerade? Mitten in einem Nest? Flüsterwind schlug mit den Flügeln und schwebte zum Dachfirst des Nachbargebäudes, sodass er mitbekam, was geschah. Neugierig wartete er.
Nun waren es fünf Flügellose, die das Nest verließen. Die Vier umringten einen einzelnen, zerrten und schubsten ihn vor sich her. Die Beute stürzte in den Schnee. Sie trug ein schäbiges, räudiges Fell, das viel von ihrer Haut unbedeckt ließ. Wie der Flügellose dalag, hingestreckt, ja wie hingegossen, konnte man meinen, Schnee und Haut bildeten eine Einheit, so weiß war sie. Auch sein Haupthaar war wie der Schnee. Einer der Jäger keilte aus, traf die Beute, die von der Wucht erbebte und sich krümmte. Japsende Laute entwichen seinen Lippen. Nun trat ein anderer zu, dann der dritte, der vierte, es ging reihum. Flüsterwind verstand die Jäger nicht. Wieso gruben sie ihre Zähne nicht in den Hals, statt das Fleisch zu malträtieren? Ein schneller Tod und ein nahrhaftes Mahl. Es wäre so einfach …
Ein hoher Laut schnitt in Flüsterwinds Ohr, ausgestoßen von einem Weibchen der Flügellosen. Schon war sie heran und sprengte den Ring der Jäger, pflanzte sich vor der Beute auf, die flügellosen Schwingen drohend erhoben. Sie fletschte die Zähne, wirbelte herum, als einer der Jäger sich näherte. Die brummten nun und fauchten und krächzten, weil ihre sicher geglaubte Beute in Gefahr war. Flüsterwind fühlte sich bestätigt: Hätten sie auf ihn gehört, den erfahrenen Jäger, hätten sie alle volle Mägen. Ein Biss in den Hals, die Beute wegschleifen an einen geschützten Ort …
Dass nun die Mutter ihr Junges verteidigte, geschah diesen Stümpern recht! Glucken, die ihren Nachwuchs beschützten, waren gefährlich und unberechenbar. Gegenseitig sahen sich die Jäger an, zornig und zugleich ratlos. Schlussendlich machten sie kehrt und traten den Rückzug an.
Die Glucke machte beruhigende Laute, beugte sich über ihr Junges und wischte mit einem Fellfetzen das Blut aus seinem Gesicht. Schließlich, auf wackeligen Beinen, erhob sich der Flügellose. Flüsterwind sah ihn genau an. Und der Flügellose, er sah ihn auch, als spüre er, dass man ihn beobachtete.
Flüsterwind fixierte seine Augen – und erschrak.
Sie waren rot, rot wie das Blut, das ihm aus der Nase über Mund und Kinn lief. Flüsterwind streckte vor Überraschung die Fittiche, sah noch einmal ganz genau hin. Kein Zweifel: Die Augen des Flügellosen waren rot. Mit aufgeregten Flügelschlägen schwang Flüsterwind sich in den Nachthimmel, weg vom Gestank der Flügellosen, schraubte sich höher und höher, getragen vom Wind sowie aufkeimender Freude. Endlich konnte er nach Hause.
Die Suche war zu Ende.
ENDE DER LESEPROBE