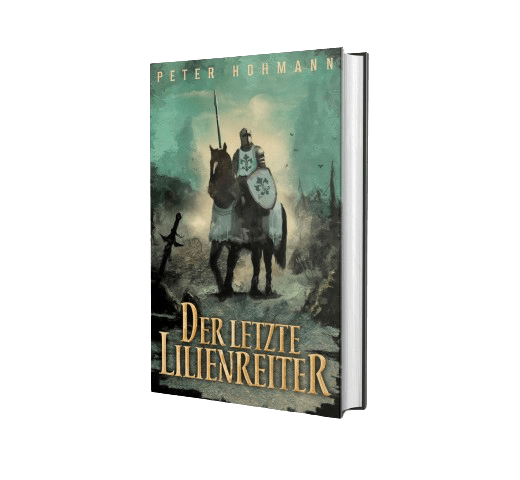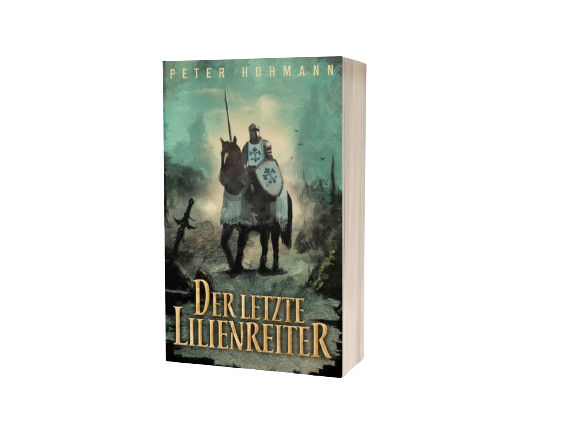Der letzte Lilienreiter
Ein gegen die Dunkelheit in seiner Seele kämpfender Ritter stellt sich der größten Herausforderung seines Lebens

„Es gibt viele Dinge im Leben, die schmerzhaft sind. Nichts aber ist so beißend, so untilgbar wie der Schmerz, der dich begleitet, wenn du Unrecht hast geschehen lassen …“
Alte Schuld und der Wunsch nach Rache treiben Padeus, den letzten Lilienreiter, zum Bergmassiv Olothirs Hörner. Ihn zieht es in die finsteren Schächte, wo seine Waffenbrüder und er einst das Böse besiegen wollten, jedoch als kriegslüsterne Schlächter zurückkehrten.
Auch die Verstoßene Alvena sowie der Einsiedler Meklas hören den Ruf der dunklen Kammern tief unter der Erde und begegnen Padeus – allerdings nicht zum ersten Mal in ihrem Leben.
Die Vergangenheit der drei ist eng verwoben mit der Zukunft des Königreichs Enodar. Und diese Zukunft sieht düster aus. Zum einen sitzt nun ein skrupelloser Thronräuber an der Macht; zum anderen schmiedet ein hinterlistiger Meistermagier ganz eigene Pläne.
Und dann lauert da auch noch eine Gefahr jenseits der Weltentore …
Ein High-Fantasy-Roman, der klassische Ideen mit neuen Ansätzen verbindet. Packend, rasant, wendungsreich – nichts ist so, wie es auf den ersten Blick scheint.
Begleiten Sie Padeus auf seinem Ritt ins Auge des Sturms!
Zwischen den Bäumen tauchte ein Reiter auf. Er war hoch von Wuchs und gehüllt in die Farben des Königs, ein grauer, zerfetzter Wappenrock mit der schwarzen Lilie in Brusthöhe. Ein eingedellter Vollhelm mit Sehschlitz verbarg sein Gesicht. Was suchte ein Ritter in dieser abgeschiedenen Region?
Immerhin ein Mann des Königs und keiner von Lord Hengars Verrätern.
Dessen ungeachtet hallten die grausamen Geschichten vom Krieg durch Alvenas Kopf, und so wich sie langsam zurück.
Etwas knackte, wahrscheinlich ein spröder Ast.
Für sie klang es wie ein Donnerschlag. Sie erstarrte vor Angst. Durch die abrupte Bewegung rutschte die Kerbe des Pfeilschafts von der Sehne.
Weder zügelte der Reiter sein Pferd, noch drehte er den Kopf. Fast schien es, eine Stoffpuppe hockte im Sattel.
Dann sah Alvena das Blut, das die linke Seite des Wappenrocks dunkel färbte, auf den metallenen Beinschienen schimmerte, das braune Fell des Schlachtrosses befleckte.
LESEPROBE
Jetzt auf Kapital 1 klicken.
Aus ihrem Versteck beobachtete Alvena das Reh, wie es sich umblickte, schnupperte, den Hals beugte und an ein paar Kräutern zupfte, die neben dem Stamm einer Eiche sprossen.Ein günstiger Augenblick für einen Schuss.Jedoch, sie rührte sich nicht, erfreute sich stattdessen am Spiel der Muskeln, das sich unter dem glänzend braunen Fell abzeichnete. Einen Hasen hatte sie bereits geschossen, und so genoss sie es, einfach dazusitzen, die Natur zu sehen, zu hören, zu riechen, Zeuge zu sein des ewigen Kreislaufs des Lebens. Irgendwo klopfte ein Specht, und der herbe Duft von Kräutern und Gräsern hing in der Luft. Die friedvolle Aura Sevestras, Göttin des Lebens, umschmeichelte Alvenas Gedanken – doch die Erinnerungen blieben, waren zu tief in ihren Geist gehämmert: ihre Eltern, die Kinder – der Berg. Wie von einer grausamen Hand gepackt, drehte sich ihr Kopf, bis sich ihr Blick zwischen den beiden Bergspitzen verfing, die wie Zwillinge in den Himmel ragten.
Olothirs Hörner.
Alvena verfluchte Olothir, auch wenn er bereits hunderte von Jahren tot war, verfluchte die dunklen Gänge, die er in den Berg getrieben hatte.
Die dunklen Gänge, in denen man sich so leicht verlieren konnte …
Unvermittelt schoss der Kopf des Rehs in die Höhe. Mit ein paar Sätzen verschwand es im Unterholz.
Habe ich es aufgeschreckt? Hat es mich gerochen? Nein, der Wind kommt …
Ein vom Waldboden gedämpftes Geräusch erreichte sie.
Hufschlag. Langsamer Hufschlag. Immerhin nicht im Galopp, sonst wäre sie schutzlos dagestanden. Mit pochendem Herzen fischte sie einen Pfeil aus dem Köcher an ihrer Hüfte und legte ihn auf die Sehne ihres Jagdbogens.
Ein Reiter tauchte zwischen den Bäumen auf. Er war hoch von Wuchs und gehüllt in die Farben des Königs, ein grauer, zerfetzter Wappenrock mit der schwarzen Lilie in Brusthöhe. Ein eingedellter Vollhelm mit Sehschlitz verbarg sein Gesicht. Was hatte der Kerl in dieser abgeschiedenen Region zu schaffen?
Immerhin ein Mann des Königs und keiner von Lord Hengars Verrätern.
Trotzdem hallten die grausamen Geschichten vom Krieg in ihrem Kopf, und so verharrte sie hinter dem Busch, darauf hoffend, dass der Soldat sie nicht bemerkte. Nein, das würde nicht funktionieren, denn sein Weg führte direkt auf sie zu.
Langsam wich sie zurück.
Etwas knackte, wahrscheinlich ein spröder Ast. Für sie klang es wie ein Donnerschlag. Sie erstarrte vor Angst. Durch die abrupte Bewegung rutschte die Kerbe des Pfeilschafts von der Sehne.
Verflucht!
Weder zügelte der Reiter sein Pferd, noch drehte er den Kopf. Fast schien es, eine Stoffpuppe hockte im Sattel, kein Mensch.
Dann sah Alvena das Blut, das die linke Seite des Wappenrocks dunkel färbte, rötlich auf den metallenen Beinschienen schimmerte, das braune Fell des Schlachtrosses befleckte. Sah das vom Sattelknauf ausgehende Seil, das um den Körper des Reiters lief und verhinderte, dass er hinunterstürzte.
War er tot – oder nur ohnmächtig? Was sollte sie tun? Ihn einfach weiterreiten lassen?
Sie überlegte einen Moment, dann stand sie vorsichtig auf und ergriff mit der freien Hand das Zaumzeug. Das Ross schnaubte und beugte den Kopf, schien froh, endlich die Bürde der Verantwortung abzugeben.
„Herr?“, fragte Alvena.
Der Ritter antwortete nicht. Als das Pferd wieder antrabte, kippte sein Kopf zur Seite, als besäße der Hals keine Wirbel. Sie schob den Kettenhandschuh seiner linken Hand etwas nach unten und fühlte seinen Puls.
Er lebte.
Hoffentlich würde er durchhalten, bis sie Beerwinden erreichten. Sie verstärkte den Griff um das Zaumzeug und begann zu laufen.
*
Mit brennenden Beinen erklomm sie die Anhöhe zum Dorf, eilte weiter, bis sie den Hauptplatz erreichte. Dort hielt sie an, mit ihren Kräften am Ende. Sie ließ den Bogen fallen, stützte die Hände auf die Oberschenkel und sog die Luft mit tiefen Zügen in ihre Lungen. Wie ein Wasserfall brauste ihr das Blut in den Ohren.
Jemand zog sie unsanft in die Höhe.
Gurai.
Sein bärtiges Gesicht war so nah, dass sie seinen schlechten Atem roch. Eine schwulstige Narbe zog sich von der Stirn unter der linken Augenklappe hindurch bis zur Wange darunter. Das verbliebene Auge lag wie eine schwarze Murmel in seiner Höhle. „Bist du wahnsinnig?“, zischte er. „Sollten die Schergen Lord Hengars herausfinden, dass wir einem Mann des Königs Zuflucht gewähren, werden sie das Dorf niederbrennen!“
„Hengar ist ein Verräter. Unsere Treue gilt dem König.“ Nach ein paar tiefen Atemzügen straffte sie ihre Haltung. „Haben uns seine Steuereintreiber jemals über Gebühr belästigt, hat er uns jemals übel gewollt?“
„Törichtes Weib! Verräter oder nicht, die Tage von König Bekias sind gezählt, und vielleicht ist dieser Kerl hier“, sein Zeigefinger wies anklagend auf den Ritter, „einer der letzten Königstreuen weit und breit.“ Er wandte sich an die Dörfler. „Ihr alle habt gehört, was der fahrende Händler vor ein paar Tagen erzählt hat. Die beiden Heere haben sich auf den Sturmwiesen versammelt zur entscheidenden Schlacht. Und wir hörten auch, dass auf jeden Königstreuen mindestens vier von Hengars Männern kamen. Man muss kein Hellseher sein, um den Ausgang zu erraten.“
Stille senkte sich über den Dorfplatz, nur eine Krähe erhob sich krächzend vom Strohdach des Haupthauses.
„Es ist wahr, der König ist tot.“
Alle Blicke hefteten sich auf den Ritter. Der Helm verlieh seinen Worten, obwohl im Flüsterton gesprochen, einen harten Klang. Er schwankte im Sattel.
Alvena trat an seine Seite, doch er hielt sich aufrecht. „Findet man mich hier, könnte euch in der Tat Gefahr drohen. Ich reite weiter.“
„Das ist Selbstmord!“, begehrte Alvena auf. „Ihr werdet verbluten, kaum dass Ihr …“
Gurais Hand fuhr ihr hart ins Gesicht.
Sie landete im Staub, schmeckte Blut auf den Lippen.
„Genug!“
Alvena spuckte aus und blickte auf. Meklas, der alte Einsiedler, löste sich aus dem Menschenring. Schwer auf seinen Stab gestützt, humpelte er zu dem Ritter. „Was bist du nur für ein Hund, Gurai! Und alle anderen auch, die einem Verletzten ihre Hilfe verwehren!“
„Halt dein Maul, alter Mann!“, rief Gurai und machte ein paar Schritte auf Meklas zu.
Anstatt zurückzuweichen, richtete Meklas seinen Stab nach vorne. „Komm nur her, dann zieh ich dir den Scheitel nach!“
Kurz sah Gurai über die Schulter – und tatsächlich gesellten sich ein paar Männer zu ihm, darunter auch Hengist, ein übler Schläger und Gurais rechte Hand. Langsam gingen sie auf Meklas zu.
„Ich mag keine Quertreiber in meinem Dorf“, sagte Gurai, „und jetzt werde ich deinen Starrkopf ein wenig weich klopfen!“
„Genau“, pflichtete Hengist bei. Ein finsteres Lächeln spielte um seine dünnen Lippen. Der Hüne hielt einen Holzknüppel in der Hand, und Alvena fürchtete, sie würden den alten Kauz nicht nur verprügeln, sondern ohne viel Federlesens totschlagen.
„Hört auf damit!“, rief sie.
Hengist stieß sie zur Seite.
Ein metallisches Schleifen ließ die Männer innehalten. Der Ritter hatte sein Schwert gezogen, doch statt zu blitzen, schien der seltsam dunkle Stahl das Licht zu schlucken. Sein Arm zitterte, die Klinge jedoch zeigte unbeirrt auf Gurai, der sein gutes Auge zusammenkniff, da er genau in die Sonne schaute.
„Falls ihr dem Mann auch nur ein Haar krümmt, werde ich euch töten.“
Gurai lachte, aber es klang, als würgte er den Laut heraus wie einen feststeckenden Hühnerknochen in der Kehle. Unter den unschlüssigen Blicken seiner Männer leckte er sich über die Lippen. „Ich … werde keine alten Männer und Krüppel schlagen. Macht, was ihr wollt. Nur macht es nicht in meinem Dorf! Und sollte jemand kommen, der euch sucht, werde ich demjenigen nur allzu gerne Auskunft geben!“
Zustimmendes Gemurmel.
Der Reiter verlor sein Schwert, es fiel auf den Boden. Meklas hob es auf und betrachtete die glanzlose Klinge. Alvena schloss die Finger um das Zaumzeug und führte das Pferd aus dem Dorf.
Meklas folgte ihr.
„Das war tapfer“, sagte er, als das Dorf hinter ihnen lag.
„Mein Vater hätte dasselbe getan.“ Sie seufzte. „Seitdem Gurai das Sagen hat …“
„Ich weiß. Er kann Leorn in keiner Weise ersetzen. Los, gehen wir zu meiner Hütte“, sagte er und legte ein Tempo vor, das mitzuhalten Alvena alle Mühe kostete. Und mit jedem Schritt, den sie tat, machte sich widerwillige Bewunderung in ihr breit. Wo war der schrullige Kerl, der nur ins Dorf kam, um sich unter den Tisch zu trinken, der dann von Königen, Schlachten, fernen Ländern und den Tücken des Schicksals faselte, bis man ihn hinauswarf? Es ging sogar die Kunde, er hätte den zweiten Blick.
Sein Gang war nicht mehr torkelnd, ja, er humpelte nicht einmal mehr, sondern bahnte sich trittsicher einen Weg zu seiner Hütte, die auf einer Lichtung im Wald stand.
Ab und an drehte er seinen Kopf und blickte den Ritter an, der wieder vornübergesunken im Sattel hockte. Dabei legte sich für einen Lidschlag ein Ausdruck auf Meklas´ Züge, den Alvena nur schwerlich deuten konnte, vor allem des dichten, weiß-grauen Vollbartes wegen. Sie siedelte ihn irgendwo zwischen schmerzhafter Erinnerung und tiefer Sorge an.
Im Wald drangen die Laute einer erwachenden Natur zu ihnen, das Rascheln von kleinem Getier im Unterholz, die trillernden Gesänge der Vögel, die im Astwerk der Bäume ihre Nester bauten. Endlich roch es nach feuchter Erde und Kräutern und nicht mehr nach dem Laub, das während des Winters unter dem Schnee vor sich hin gefault war. Allmählich wich die Anspannung von ihr; einzig die aufgeplatzte Lippe erinnerte sie an den Vorfall im Dorf.
Trotzdem erfüllte sie die Blessur mit Stolz. Sie war nicht gewichen, hatte einer gerechten Sache ihre Stimme gegeben – ganz wie es ihr Vater sie gelehrt hatte.
Es gibt viele Dinge im Leben, die schmerzhaft sind. Nichts aber ist so beißend, so untilgbar wie der Schmerz, der dich begleitet, wenn du Unrecht hast geschehen lassen.
Alvena lächelte. Vater und seine Prinzipien. Ehern und unerschütterlich, als hätte sie jemand mit feurigem Griffel in seine Seele geritzt.
Im selben Moment kamen die Schuldgefühle.
Du hast ihn auf dem Gewissen – und Mutter auch!
Wie flüssiges Feuer schwappten die Erinnerungen durch ihren Kopf, brannten sich ein, jedes Mal aufs Neue. Irgendwann, wenn die Schuld ihren Verstand aufgefressen hätte, käme der Wahnsinn. Und sie würde ihn begrüßen.
Weshalb hatte sie auch in die Minen laufen müssen? Und die anderen Kinder angestachelt, ihr zu folgen? Eine Mutprobe. Wer sich nicht traute, war ein Feigling. Niemand war gerne ein Feigling. Zehn Kinder verschwanden in den Minen – zusammen mit allen Männern und Frauen, die sich auf die Suche nach ihnen machten. Insgesamt dreißig Leute. Darunter auch ihre Eltern.
Nur sie selbst kehrte zurück, gesund und ohne Erinnerung an das, was geschehen war. Sie wusste lediglich, dass sie in die Minen gelaufen war, nachdem es wieder passiert war. Es, der Makel, das Böse …
Verärgert spuckte sie aus. Sie war stark, das wusste sie, doch in dunklen Nächten, wenn der eisige Wind aus den Bergen an den Fensterläden rüttelte, senkte sich die Einsamkeit oft wie eine erstickende Decke auf sie herab. Da vermisste sie ihre Eltern, vor allem Vaters brummige Stimme, seine breiten Schultern und starken Hände, mit denen er sie als kleines Kind in den Schlaf gewiegt hatte, vermisste das Kitzeln seines Bartes auf ihrer Wange, wenn er sie fest ans Herz gedrückt hatte.
„Hilf mir, den Mann loszubinden“, sagte Meklas.
Stumm trat Alvena an das Pferd und stellte sich auf die Zehenspitzen, um den Strick am Sattelknauf zu lösen.
Zusammen trugen sie den Verwundeten in die Hütte. Alvena fürchtete, ihre Schultern würden herausbrechen, obwohl es nur wenige Meter bis zu dem mit Stroh gedeckten Bett waren.
Nachdem sie ihn abgelegt hatten, fasste sich Meklas mit beiden Händen an den Rücken und streckte sich. „Ich werde zu alt für so etwas.“
„Warst du früher ein Krieger?“, fragte Alvena, die Augen auf das Kettenhemd, den Schild, das Schwert und den Morgenstern gerichtet, die mit Nägeln an der Wand befestigt waren. Nirgends Rost, im Gegenteil: Die Ringe des geölten Kettenhemdes glimmerten im Sonnenlicht, das in einem dicken Streifen durch das gegenüberliegende Fenster fiel.
„Wir müssen uns um den Ritter kümmern“, erwiderte Meklas, nachdem er ihr ein paar Herzschläge lang in die Augen geblickt hatte.
Alvena nickte, erhitzte auf Meklas´ Geheiß über der Feuerstelle einen Topf mit Wasser, während dieser den Schwertgürtel abschnallte, die Klinge, die er die ganze Zeit über getragen hatte, in die Scheide steckte, den Wappenrock mit einem gebogenem Dolch aufschnitt und zuletzt den Helm entfernte. Er sog die Luft ein, als das Gesicht darunter zum Vorschein kam.
Auch ihr Atem fing sich in der Kehle. Gut, er war ansehnlich, aber das allein war es nicht. Weil er so jung aussah? Sie schätzte ihn auf ein viertel Jahrhundert, also gerade mal fünf Jahre älter als sie. Vielleicht lag es an seinem Haar? Es war weiß wie frischer Schnee und zu vielen Zöpfen geflochten. Irgendetwas kitzelte ihr Gedächtnis. Sie konnte den Finger nicht darauf legen, doch hatte sie das untrügliche Gefühl, den Mann kennen zu müssen. Kurz öffneten sich seine Augen, dann fielen sie wieder zu.
Sie waren grau, grau wie ein Winterhimmel.
Weißes Haar, graue Augen …
„Hol das Wasser“, sagte Meklas, während er die Schnallen und Arretierungen des Brustpanzers öffnete. „Beim Kettenhemd brauche ich deine Hilfe.“
Alvena ging zu der Feuerstelle, drehte sich aber noch einmal um. „Wer ist er?“
„Später“, murmelte Meklas, der weiterhin an der Rüstung herumfuhrwerkte.
Der Panzer ließ sich gut entfernen, das Kettenhemd war eine andere Sache: Alvena musste den Oberkörper des Verwundeten aufrecht halten, während Meklas ihm das Ringgeflecht vorsichtig über den Kopf streifte. Schmerzerfüllt stöhnte der Mann auf: Ein abgebrochener Pfeil steckte unterhalb der rechten Schulter in seinem Rücken, und das Kettenhemd zerrte daran. Aber das war nicht die einzige Verletzung: Über der linken Hüfte prangte ein rundes, tiefes Loch, aus dem Blut quoll.
Alvena wischte es mit einem Lappen fort, den sie in das heiße Wasser getaucht hatte, dann trat Meklas mit Messer, Nadel und Faden heran.
„Was tust du?“, fragte sie erschrocken, weil Meklas das Messer an der runden Wunde ansetzte.
„So wird das Fleisch nicht richtig verheilen. Ein Speer oder eine Lanze hat diese Wunde verursacht. Ich muss sie erweitern, bevor ich sie vernähen kann.“
Alvena wandte den Kopf ab, als die Messerspitze im Fleisch versank und neues Blut hervorpresste. Sie konnte nicht mehr tun, als dem Ritter den Schweiß von der Stirn zu tupfen. Er drehte den Kopf von einer Seite zur anderen, murmelte dabei. Sie hörte lediglich das Wort „König“ heraus.
Nachdem Meklas auch den Pfeil herausgeschnitten und die Wunden verbunden hatte, setzten sich beide erschöpft an den Tisch neben der Feuerstelle.
„Wird er durchkommen?“ fragte sie leise, ihr Blick auf das Laken gerichtet, das sich kaum merkbar im Takt seiner Atemzüge hob und senkte.
Meklas schien durch sie hindurchzustarren. Wortlos stand er auf, holte einen Krug, stellte zwei Tonbecher auf den Tisch und goss ein.
Vorher noch von Kraft und Entschlossenheit beseelt, war er jetzt wieder ganz der verlorene, knittrige Einsiedler, den niemand recht verstand. Er stürzte den Inhalt des Bechers hinunter und füllte nach.
Seufzend griff Alvena nach dem irdenen Gefäß und trank. Im nächsten Moment meinte sie, eine Feuersbrunst wütete durch ihren Mund. Trotzdem schluckte sie die Flüssigkeit, das Brennen schoss ihr in den Bauch. Nach einem zweiten und einem dritten Schluck war ihr so heiß, dass sie meinte, vor der Esse einer Schmiede zu sitzen.
Meklas wollte nachschenken. Sie hielt beide Hände über den Becher und schüttelte den Kopf. Er zuckte die Schultern, zwinkerte ihr dann zu und stürzte das widerliche Zeug abermals in seinen Rachen.
Nach einiger Zeit des Schweigens sank Alvena gegen die Lehne ihres Stuhls und ließ ihre Gedanken fliegen. Ein Fehler: Wie Aasgeier kreisten sie unaufhörlich um ihre Eltern, den Berg, die Kinder …
Plötzlich spürte sie das Kribbeln auf der Haut, als überzöge eine Eisschicht ihren Körper. Sie keuchte und schoss in die Höhe, knallte dabei mit dem Knie gegen Tisch, dass dieser hüpfte. Meklas´ Becher fiel um, der Schnaps breitete sich auf dem dunklen Holz aus, rann in die Furchen und Rillen. Auch der Krug wankte. Meklas bekam ihn zu fassen, bevor er umkippte. „Glück gehabt“, schnarrte er, seine Stimme leicht verwischt.
„Entschuldige“, murmelte sie, „aber ich … ich muss nach draußen, mir die Beine vertreten.“
Abermals zuckte Meklas mit den Schultern und brabbelte irgendetwas.
Laue Frühlingsluft empfing Alvena. Sie hob die Hand vor Augen, da das Licht der untergehenden Sonne zwischen den Bäumen hindurchstach. Einige tiefe Atemzüge, doch ihr Unwohlsein blieb, steigerte sich sogar, bis die Kälte zu einem Brennen wurde, allumfassend und vernichtend. Sie stolperte ein paar Schritte, dann brach sie in die Knie und wimmerte. „Nein, ich will … will es nicht!“
Ihr Körper zuckte. Sie stöhnte. Der Schmerz wanderte nach innen, in ihren Bauch, in ihr Herz, und riss dort mit glühenden Klauen, schlimmer als all die Male zuvor. Viel schlimmer. Es wollte wieder hinaus, wie damals, kurz bevor sie in den Berg gegangen war.
Ein gutturaler Schrei entriss sich ihrer Kehle, ehe es aus ihr herausbrauch, urgewaltig und verheerend. Ein Strahl, in dem sich das Feuer wand wie Schlangenleiber, weißorange und glutrot, zischte über die Lichtung. Traf einen Baum, der sich knisternd und knackend entzündete, die Rinde schälte sich ab, verkohlte.
Am Boden liegend, betrachtete sie die Flammen, die sich in wildem Tanz am Stamm emporschlängelten. Funken stoben umher, als ein Windstoß sie erfasste und zu anderen Bäumen trug. Einen Moment meinte sie, eine Gestalt in den Flammen zu sehen, doch alles verschwamm, weil ihr die Hitze und der Rauch Tränen in die Augen trieben.
Auf zitternden Beinen wankte sie zu einem Regenfass, nahm einen Eimer, schöpfte Wasser. Taumelte auf das Inferno zu. Nach einigen Schritten entglitt der Eimer ihrem Griff und klatschte auf den Boden.
Dann, urplötzlich, erstarben die Flammen. Einzig der verkohlte Baum, der in der Luft hängende Rauch und der brandige Geruch erinnerten an das Geschehen.
„Sevestra sei gedankt!“, seufzte Alvena, auch wenn sie nicht glaubte, dass die Göttin der Wälder für diese glückliche Fügung verantwortlich war.
Erschöpft sank sie zu Boden, entledigte sich aller Gedanken, bettete den Kopf auf dem Gras, bis das Himmelszelt ihr Blickfeld füllte. Die ersten Sterne funkelten wie zwinkernde Augen.
Dann … geschah etwas. Was genau, das konnte sie im ersten Moment nicht sagen. Aber als sie aufstand und sich umsah, unterdrückte sie einen Schrei der Furcht.
Der Wald war weg!
Und der Himmel!
Alles um sie herum waberte in verwaschenem Grau, durchsetzt mit weißen Punkten, fast so, als befände sie sich in einer Wolke.
„Fürchte dich nicht“, wehte es an ihr Ohr.
Alvena wirbelte herum.
Eine Frau trat aus dem Nebel. Groß, die Haltung edel, das lange Haar grau durchschossen. Krähenfüße lagen unter warmen, grünen Augen. Ihr Lächeln wirkte offen.
„Wo bin ich?“
„Das weiß nicht einmal ich.“ Die Frau machte eine umfassende Bewegung, die ihren hellblauen, mit silbernen Verzierungen durchwirkten Umhang rascheln ließ. „Ich kenne diesen Ort nur aus Sagen: Nifilos, die Welt der Gedanken und Gefühle, die das Fleisch nicht erreichen kann.“
„Ich verstehe nicht.“
„Dein Körper ist weiterhin in deiner Welt“, sagte die Frau und hob die Hand, als wollte sie Alvena anfassen. Ihre Lippen zitterten, während sie die Hand wieder sinken ließ. „Ich weiß nicht, was passieren würde, sollte ich dich berühren.“ Tränen zogen glitzernde Spuren über ihre Wangen. „Ich habe dich gespürt, als sich deine Magie Bahn gebrochen hat, wild und ungestüm. Das Wissen, dass du lebst, hat mir Hoffnung gegeben in den dunkelsten Stunden.“
Alvenas Verwirrung wuchs mit jedem Atemzug. „Wer seid Ihr? Ihr scheint mich zu kennen, doch ich kenne Euch nicht.“
„Wirklich nicht? Erinnere dich an die Momente, wenn deine Magie herausgebrochen ist wie Wasser aus einem geborstenen Damm. Hast du da nicht gespürt, dass jemand nach dir sucht?“
„Ich … ich weiß nicht. Ich will keine Magie. Meine Eltern besitzen … besaßen diese Gabe nicht. Ich habe Angst davor.“
„Deine Eltern“, echote die Frau. „Hat deine … Mutter auch dein nachtschwarzes Haar, deine smaragdgrünen Augen? Den wohlgeformten Körper?“ Sie verstummte, schloss einen Moment die Augen. „Wenn du versuchst, Miraibas Gabe zu unterdrücken, wird sie immer wieder hervorbrechen und sich deiner Kontrolle entziehen. Du musst dich ihr öffnen. Wie eine Blüte, die sich dem Sonnenlicht entgegenstreckt. Versteckst du dich weiterhin vor ihr, wird sie dich eines Tages verbrennen.“
„Das ist nicht wahr!“
Die Frau sah sie nachsichtig an, als wäre sie ein Kind, das eine lässliche Dummheit begangen hatte. „Es liegt in deiner Natur. Du kannst der Magie nicht entrinnen. Sie ist in dir, so wie das Blut in jedem Lebewesen ist.“
Auf einmal begann die Frau zu verblassen, wie ein Nebelstreifen, der sich in der Sonne auflöste. Immer noch lächelte sie. „Beim nächsten Mal akzeptiere die Magie als Teil von dir – und sie wird dich akzeptieren. Ich werde deinen Ruf hören. Deine Kraft wächst mit jedem Tag. Ich bin stolz auf dich, meine Tochter.“
ENDE DER LESEPROBE